Wetterlage und Entwicklung
Ungewöhnlich rasch vollzog sich im September 2008 in Deutschland der Übergang vom Spätsommer zum Herbst. Nach einer
recht warmen ersten Monatshälfte ließ eine über fast zwei Wochen andauernde Nordost- bis Ostströmung die Temperaturen ab
der Monatsmitte sinken und kehrte den anfänglichen Wärmeüberschuss noch in eine deutlich negative Abweichung um. Erstmals
seit dem November des vergangenen Jahres verlief damit ein Monat im deutschlandweiten Durchschnitt wieder zu kalt. Am Ende
standen im Flächenmittel -0,9 K zu Buche. Während es im Norden örtlich sogar um einige Zehntel Grad wärmer als im Schnitt
der Jahre 1961 bis 1990 war (z.B. Hamburg +13,7 °C, +0,2 K), wichen die Temperaturen im Süden deutlich nach unten von
den langjährigen Mittelwerten ab. In Saarbrücken beispielsweise konnte nur eine Monatsmitteltemperatur von +12,1 °C
errechnet werden - das sind ganze 2,0 K weniger als sonst im September üblich. Ein inhomogenes Bild gab die
Niederschlagsverteilung ab, hauptsächlich im Norden fiel jedoch teilweise deutlich weniger Niederschlag als im Schnitt
(z.B. Bremen 24,9 mm, 44 Prozent des Mittels der Jahre 1961 bis 1990). Höhere Mengen als normalerweise im September zu
verzeichnen sind hatte das Saarland zu bieten (z.B. Trier 79,5 mm, 134 Prozent). Mit Ausnahme einiger Regionen im Nordwesten
schien die Sonne sehr viel seltener als im Klimamittel. Als besonders benachteiligt ging aus dieser Statistik die Mitte und
der Süden hervor, in Augsburg zeichnete der Sonnenscheinautograph gerade einmal 106,1 Sonnenscheinstunden auf
(62 Prozent).
In Karlsruhe handelte es sich beim September 2008 um den ersten zu kalten Monat seit April. Waren die Abweichungen damals
nur unbedeutender Natur (-0,1 K), konnte man in diesem Monat doch von einer signifikanten Anomalie (-1,3 K) sprechen. Mit
49,2 mm wich die Niederschlagssumme nur unwesentlich vom Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 ab (92 Prozent). Dagegen schien
die Sonne mit 115,3 Stunden längst nicht so häufig wie das in einem Septembermonat zu erwarten wäre (67 Prozent).
 |
01.09., 11:55 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Pünktlich zum meteorologisch definierten Herbstanfang am 1. September beendete die von West nach Ost über Deutschland hinweg
ziehende Kaltfront von Tiefdruckgebiet "Karla" eine rund einwöchige sommerliche Witterungsphase. Die Kaltfrontpassage selbst
ging am frühen Morgen vor allem in Baden-Württemberg mit zum Teil kräftigen Gewittern einher, die am Vormittag unter
Abschwächung auch den Norden und die Mitte Bayerns erfassten. In Lahr fielen binnen sechs Stunden 56 mm Regen, auf dem
Schnarrenberg in Stuttgart waren es 26 mm. In der Ortenau kam es zu örtlichen Überschwemmungen. Eine weitere Gewitterzone
verlagerte sich gleichzeitig über Schleswig-Holstein ostwärts, dazwischen blieb es in der Mitte Deutschlands stellenweise
sogar trocken.
Bei den Britischen Inseln lag am 2. ein umfangreiches und hochreichendes Tiefdrucksystem, zu dem letztendlich auch "Karla"
gehörte. Ein Kern dieses Systems erhielt den Namen "Lieselotte". Auf der Vorderseite des gesamten Systems wurde über
Mitteleuropa mit einer südwestlichen Strömung erneut warme Luft wetterwirksam. Dies spiegelte sich beim Wetter und in den
Höchsttemperaturen wider; bei viel Sonne wurden in der Mitte und im Süden des Landes verbreitet Werte bis +25 °C
gemessen, in Karlsruhe sogar +26,2 °C. Lediglich der Nordwesten musste unter dichten Wolken und bei etwas Regen mit
knapp +20 °C vorlieb nehmen. Am Abend erreichte die Kaltfront von Tief "Lieselotte", das inzwischen über Südskandinavien
analysiert werden konnte, den Nordwesten Deutschlands und wanderte am 3. langsam über das Bundesgebiet hinweg
südostwärts. Dabei regnete es vor allem in einem breiten Streifen quer über der Mitte kräftig, vereinzelt waren auch
Gewitter mit von der Partie. Bis zum Abend meldeten beispielsweise Lahr und Freiburg/Flugplatz je 19 mm Regen in zwölf
Stunden. Im Süden und Osten Bayerns blieb es bis zum Abend trocken, dort kam der Regen erst in der Nacht zum 4. an.
 |
04.09., 12:55 UTC, NOAA VIS
Quelle: DLR |
Am 4. hatte sich "Lieselotte" über der Mitte Skandinaviens eingefunden. Von dort aus erstreckte sich die ursprüngliche
Kaltfront des Tiefs als langgezogene Luftmassengrenze über Nordfinnland, das Baltikum, Osteuropa und die Alpen hinweg zur
Iberischen Halbinsel. Sie trennte subtropische Warmluft im Süden von deutlich kühlerer Meeresluft im Norden. An der
Luftmassengrenze liefen, meist gepaart mit kurzwelligen Trögen, in der südwestlichen Strömung Wellen nach Nordosten
ab. Dabei wurde auch über dem Süden Deutschlands die Luft großräumigen Hebungsprozessen unterworfen. In Baden-Württemberg
und Bayern resultierte daraus vielerorts etwas Regen, im fränkischen Roth gingen bis zum Abend 12-stündig 13 mm nieder. Im
Norden herrschte dagegen oft heiteres Wetter.
Reste der Luftmassengrenze konnten am 5. anfangs noch in Form von dichten Wolken über Süddeutschland identifiziert
werden, die aber bald immer mehr der Sonne wichen. Vor einem weiteren kräftigen Tief ("Mattea"), das sich mit seinem Zentrum
zu den Britischen Inseln bewegte, drehte die Strömung über Mitteleuropa auf südliche Richtungen. Damit wurde erneut
kurzzeitig sehr warme Subtropikluft herangeführt, in Kempten stiegen die Temperaturen bis auf +29,5 °C. Am späten Abend
näherte sich jedoch die Kaltfront samt vorlaufender Konvergenz des Tiefs, im Westen Deutschlands konnten einzelne Gewitter
beobachtet werden. Die Front des nahezu ortsfesten Tiefs kam einen Tag später wiederum nur zögernd ostwärts voran. In
mehreren Staffeln und verbunden mit schauerartigen Regenfällen floss am Wochenende 6./7. von Westen her kühlere Luft
ein. Besonders in Bayern konnte sich die Warmluft allerdings noch einige Zeit halten. Regensburg verzeichnete am 6. noch
einmal hochsommerliche +30,4 °C, ehe dort am 7. - nach Kaltfrontdurchgang - nurmehr +17,0 °C gemessen wurden.
 |
08.09., 12:23 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Der zu Tief "Mattea" gehörende Höhentrog schwenkte mit seiner Achse am 8. über Deutschland nach Osten. Vor einem weiteren
Trog, der von Grönland bis zu den Azoren reichte, wölbte sich über West- und Mitteleuropa ein Hochdruckrücken auf. Am Boden
wanderte korrespondierend dazu Hoch "Charlie" über Südfrankreich und die Alpen ostwärts. Während am 8. noch letzte kurze
Regenschauer niedergingen, setzte sich am 9. nach morgendlichem Nebel verbreitet die Sonne durch und ließ die Temperaturen
entlang des Rheins und örtlich in Bayern auf sommerliche Werte steigen (z.B. Karlsruhe +26,6 °C).
Im Vorfeld des Höhentroges, der die Britischen Inseln nordostwärts passierte, begann es bereits am späten Abend des 9. im
Westen Deutschlands zu regnen. Das okkludierte Frontensystem des zugehörigen Bodentiefs überquerte das Bundesgebiet in der
ersten Tageshälfte des 10. mit etwas Regen im Süden ostwärts. Zwar schien am Nachmittag immer öfter die Sonne, jedoch
reichte es trotzdem nur zu Tageshöchsttemperaturen um +20 °C.
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
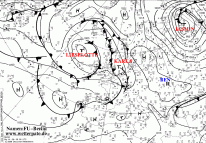 |
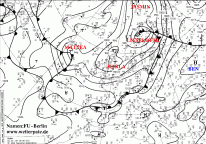 |
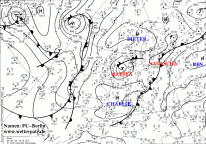 |
| 01.09.2008, 00 UTC |
04.09.2008, 00 UTC |
08.09.2008, 00 UTC |
|
850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
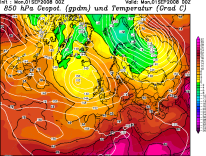 |
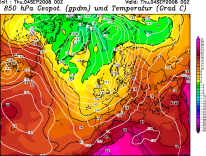 |
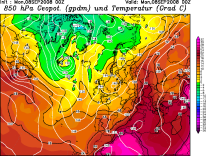 |
| 01.09.2008, 00 UTC |
04.09.2008, 00 UTC |
08.09.2008, 00 UTC |
Zum 11. hatte sich über Skandinavien das ausgeprägte Hochdruckgebiet "Dieter" breit gemacht. In der Höhe etablierte sich
hohes Geopotential ebenfalls über dem nordeuropäischen Raum, ein Hochdruckrücken erstreckte sich vom westlichen Mittelmeer
nordwärts bis zur Nordsee. Der ehemalige Hurrikan "Hanna" lag knapp nordwestlich der Britischen Inseln inmitten eines
langwelligen Höhentroges. Aus einem weiteren Höhentrog über Südwesteuropa lief ein kurzwelliger Anteil am Abend nach
Nordosten ab. Die damit verbundenen Hebungsprozesse führten zur Bildung eines ausgedehnten Wolkengebietes, aus dem es nach
einem sonnigen und mit Ausnahme des Nordens und Nordostens bundesweit sommerlich warmen Tag am späten Nachmittag im
Südwesten leicht regnete. Im Süden Bayerns kamen aus den Alpen heraus am Abend kräftige Gewitter auf, auf dem Wendelstein
fielen 20 mm innerhalb von sechs Stunden.
 |
12.09., 11:36 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
Der Südteil des Langwellentroges vor Westeuropa war am 12. bei den Britischen Inseln einem Abschnürungsprozess
unterworfen. Das daraus hervorgegangene Höhentief verlagerte sich bis zum Abend des 13. über die Mitte Frankreichs nach
Oberitalien. Am Süd- und Ostrand von Hoch "Dieter" stellte sich indes über Osteuropa eine stramme Nordostströmung ein, mit
der zunehmend kalte Festlandsluft nach Mitteleuropa gelenkt wurde. Da auch von Südwesten kühlere Meeresluft nach Nordosten
verfrachtet wurde, geriet die warme Luftmasse über der Mitte Deutschlands immer mehr in die Enge. An der so entstandenen
Luftmassengrenze regnete es am 12. von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Bayern ergiebig, Roth meldete 52 mm binnen
eines halben Tages. Letztendlich behielt die Nordostströmung die Oberhand, sodass die Luftmassengrenze am 13. nach Südwesten
in Bewegung kam. Entsprechend regnete es dort an diesem Tag am meisten, dabei traten des öfteren Mengen über 20 mm in zwölf
Stunden auf (z.B. Freiburg/Flugplatz 31 mm). Ansonsten schien vor allem in der Mitte des Landes häufig die Sonne.
Insgesamt markierten die Tage um die Monatsmitte eine grundlegende Umstellung der großräumigen Wettersituation. Verlief der
Monat bis dahin fast überall teilweise deutlich zu warm, so kehrten sich die Abweichungen von nun an langsam ins Gegenteil
um. Zwischen dem immer mächtiger werdenden Hoch "Dieter" über Skandinavien und Tief "Olivia" über Mittelitalien wurde mit
einer östlichen Strömung am 14. und 15. von Nordosten her immer kältere Luft nach Mitteleuropa transportiert. Ein in dieser
Strömung mitschwimmendes kleines Höhentief, ein sogenannter "Kaltlufttropfen", bewegte sich am 14. über die Mitte
Deutschlands hinweg zu den Alpen. Warmluftadvektion auf seiner Rückseite ließ es am 14. besonders im Nordosten, am 15. in
der Mitte und im Südosten regnen. Im Dauerregen wurden hauptsächlich in Bayern nur noch einstellige Höchsttemperaturen
gemessen, beispielsweise in Straubing +8,7 °C.
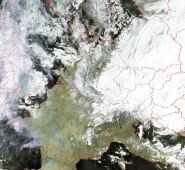 |
 |
16.09., 10:14 UTC, NOAA-17 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
20.09., 10:07 UTC, NOAA VIS
Quelle: DLR |
Vom 16. bis zum 19. blieb die östliche Strömungskomponente erhalten. Zwar verschob sich "Dieter" mit seinem Schwerpunkt
langsam nach Nordwestrussland; allerdings ging von dem Hoch noch immer ein mächtiger Keil nach Westen aus, der am 19. in
eine weitere Hochdruckzelle ("Erich") bei den Britischen Inseln mündete. An den vier Tagen herrschte ruhiges Herbstwetter
mit zum Teil zäher hochnebelartiger Bewölkung im Osten und Nordosten Deutschlands sowie mehr Sonne in der
Westhälfte. Stellenweise - in erster Linie im Nordosten - fiel etwas Regen. Die Temperaturen stiegen im Westen auf Werte
um +15 °C, im Osten konnten vielfach nur einstellige Maxima notiert werden. In den Nächten gab es vielerorts ersten
Bodenfrost.
Daran änderte sich auch am 20. und 21. noch nichts Wesentliches. Hoch "Erich" setzte sich vor der Deutschen Bucht fest und
sorgte für teils heiteres, teils wolkiges und ruhiges Wetter mit kalten Nächten und frischen bis milden
Tagestemperaturen. Wie kalt die Luft tatsächlich war, zeigen insgesamt 18 ein- bzw. neu aufgestellte Dekadenrekorde für die
Tiefsttemperatur zwischen dem 17. und 22. Ein gesonderter Artikel dazu
ist hier abrufbar.
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
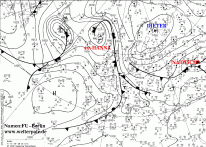 |
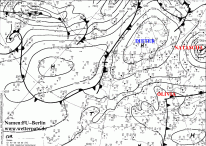 |
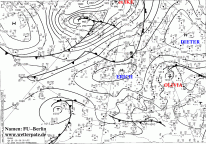 |
| 12.09.2008, 00 UTC |
16.09.2008, 00 UTC |
20.09.2008, 00 UTC |
|
850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
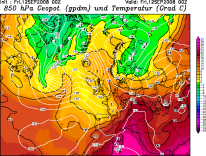 |
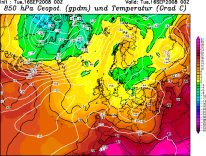 |
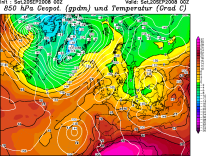 |
| 12.09.2008, 00 UTC |
16.09.2008, 00 UTC |
20.09.2008, 00 UTC |
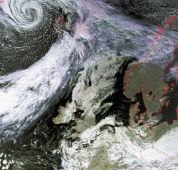 |
24.09., 13:01 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Ein Beleg für die Beständigkeit der Wetterlage war das hochreichende Tiefdrucksystem "Olivia", das auch am 22. noch über
Südosteuropa ausgemacht werden konnte. Ein kleiner Kern des flächenmäßig ausgedehnten Komplexes zog tagsüber von Nord nach
Süd über Deutschland hinweg. Verbreitet gingen schauerartige Regenfälle und sogar einzelne Gewitter - beispielsweise in
Ulm - nieder. Am 23. und 24. verlagerte sich das kleine Höhentief nach Kroatien und übernahm dort die Funktion des
steuernden Zentrums des Höhentiefkomplexes, der dann vom Schwarzen Meer bis nach Südfrankreich reichte. Über dem nördlichen
Mitteleuropa rückte Hoch "Fody" an die Stelle seines Vorgängers "Erich". Somit waren die Voraussetzungen für weitere
Kaltluftzufuhr aus Osten gegeben, wenngleich es sich nicht mehr um so extrem kalte Luft wie um die Monatsmitte
handelte. Während am 23. die weit zurückhängende Okklusion von "Olivia" dem Norden und der Mitte der Bundesrepublik länger
anhaltenden Regen mit Mengen meist zwischen 10 und 20 mm binnen zwölf Stunden brachte, konnte sich am 24. die Sonne wieder
öfter behaupten.
Erst gegen Ende des Monats begann ein Umbau an den großräumigen Strukturen. Der südosteuropäische Tiefdruckkomplex
verlagerte sich weiter südwärts und verlor den Bezug zum mitteleuropäischen Wettergeschehen. Hoch "Fody" arbeitete sich bis
zum 27. mit seinem Schwerpunkt nach Deutschland voran, sodass der Zustrom kalter Luft aus Osten endgültig unterbunden
wurde. Abgesehen von einigen dichteren Wolkenfeldern und letztem Regen im Süden am 25. schien an den beiden anderen Tagen
ausgiebig die Sonne und es wurde auch im Norden und Osten bis nahe +20 °C warm. In den windschwachen und sternenklaren
Nächten kühlte die Luft jedoch wiederum stark aus - Tiefsttemperaturen zwischen +5 und 0 °C waren in der Mitte und im
Süden des Landes die Regel.
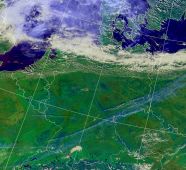 |
 |
28.09., 12:15 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: B. J. Burton |
30.09., 09:50 UTC, NOAA-17 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Am 28. schien in nahezu ganz Deutschland die Sonne, in den Norden drang mit der Kaltfront von Tief "Pelagia" über
Nordskandinavien nach langer Zeit wieder ein atlantischer Tiefausläufer ein. Aus dichten Wolken fiel dort etwas Regen. Da
der korrespondierende Höhentrog rasch nach Osten schwenkte, fehlten für größere Mengen aber die dynamischen
Hebungsantriebe.
Stück für Stück rückte die nordatlantische Frontalzone von Norden her an den europäischen Kontinent heran; unter
Wellenbildung erreichte die Kaltfront von "Pelagia" am 29. auch die Mitte und den Süden Deutschlands. Teilweise regnete es
dabei etwas. Am 30. näherte sich mit Tief "Quinta", das sich bei Island entwickelt hatte, der erste Herbststurm des
Jahres. Das okkludierende Frontensystem griff bereits am Morgen auf den Nordwesten über, bis zum Abend breitete sich der
länger anhaltende Regen auf das ganze Land aus. Der Südwestwind frischte merklich auf, auf den Gipfeln der Mittelgebirge
konnten erste schwere Sturmböen beobachtet werden. Mit 126 km/h blies der Wind auf dem Brocken im Harz gar schon in
Orkanstärke.
|
Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD
|
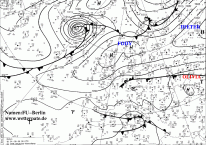 |
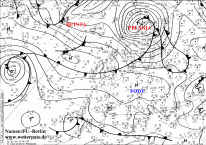 |
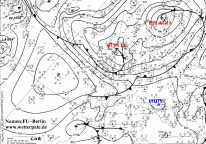 |
| 24.09.2008, 00 UTC |
28.09.2008, 00 UTC |
30.09.2008, 00 UTC |
|
850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale
|
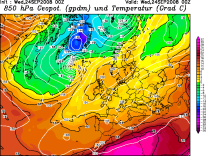 |
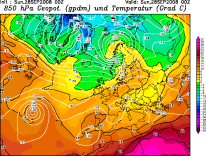 |
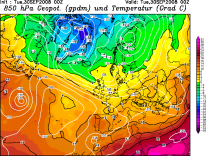 |
| 24.09.2008, 00 UTC |
28.09.2008, 00 UTC |
30.09.2008, 00 UTC |
Monatswerte
Nachstehend Monatswerte vom September 2008 für ausgewählte Stationen in Deutschland.
"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme
und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich
mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):
| Ort |
Temp. |
Vgl. |
Nds. |
Vgl. |
Sonne |
Vgl. |
Westermarkelsdorf
Konstanz
Karlsruhe |
+14,2 °C
+13,3 °C
+14,1 °C |
+0,3 K
-1,4 K
-1,3 K |
28,4 mm
59,2 mm
49,2 mm |
54%
84%
92% |
128,1 h
140,1 h
115,3 h |
80%
82%
67% |
|
Text und Gestaltung: CE

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|

