Eine der prägnantesten Unwetterlagen des Sommers 2009 stellte sich in Mittel- und in Teilen Osteuropas vom 21. bis zum
25. Juli ein. Heftige Gewitter mit schweren Sturmböen und großem Hagel richteten verbreitet Schäden an; acht Menschen kamen
ums Leben, etwa hundert wurden verletzt.
Wetterlage und Entwicklung
Eingangs der letzten Julidekade wies die großräumige Strömungskonfiguration über dem Nordatlantik und Europa klassische
Merkmale einer sommerlichen Unwetterlage auf. Über dem Ostatlantik reichte ein ausgeprägter Langwellentrog nach Süden bis
zu den Kanaren, auf seiner Vorderseite kam kräftige Warmluftadvektion in Gang. Dabei wurde heiße Subtropikluft aus
Nordafrika nordostwärts geführt, am Abend des 21. konnten über Südfrankreich im 850-hPa-Niveau (ca. 1500 Meter Höhe) mehr
als +25 °C analysiert werden. Die Vordergrenze der Warmluft wurde am Boden durch die am 21. und 22. nordostwärts
ziehende Warmfront von Tiefdruckgebiet "Wolfgang" mit Zentrum bei den Britischen Inseln markiert. Im Bereich
der Warmluft wölbte sich ein Hochdruckrücken auf, dessen Achse am Morgen des 22. über Ostdeutschland zur Mitte
Skandinaviens verlief. West- und Mitteleuropa lagen zu diesem Zeitpunkt also bereits unter dem Einfluss der sich
annähernden Vorderseite des Langwellentroges.
Bodendruckanalysen vom 21. bis 25.07.2009, jeweils 00 UTC
Quelle: FU Berlin / DWD
|
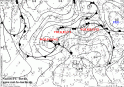 |
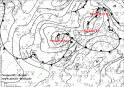 |
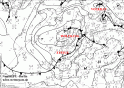 |
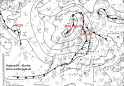 |
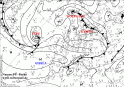 |
| 21.07.2009, 00 UTC |
22.07.2009, 00 UTC |
23.07.2009, 00 UTC |
24.07.2009, 00 UTC |
25.07.2009, 00 UTC |
850-hPa-Geopotential und -Temperatur vom 21. bis 25.07.2009, jeweils 00 UTC
Quelle: Wetterzentrale
|
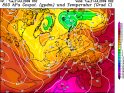 |
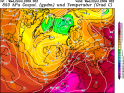 |
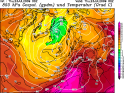 |
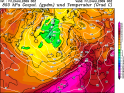 |
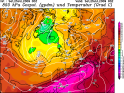 |
| 21.07.2009, 00 UTC |
22.07.2009, 00 UTC |
23.07.2009, 00 UTC |
24.07.2009, 00 UTC |
25.07.2009, 00 UTC |
Entsprechend entwickelten sich über Ostfrankreich und Benelux im Umfeld eines ersten markanten, aus dem Langwellentrog
herauslaufenden kurzwelligen Troganteils noch am Abend des 21. kräftige Gewitter, die über Nordrhein-Westfalen ostwärts
zogen und in der Nacht zum 22. über der Norddeutschen Tiefebene zu einem mesoskaligen konvektiven System (MCS)
verschmolzen. Dieses bewegte sich bis zum Morgen über Sachsen-Anhalt und den Süden Brandenburgs nach Südpolen. In Osnabrück
fielen zwischen 23 und 00 Uhr MESZ 23 mm Regen, in der Nähe von Paderborn wurden im selben Zeitraum Böen bis 102 km/h
gemessen. Gleichzeitig schoben sich entlang einer von Südwest nach Nordost ausgerichteten Konvergenzlinie Schauer und
Gewitter von der Mitte Frankreichs über Rheinland-Pfalz und Hessen in die Mitte Deutschlands, am Vormittag des 22. auch
nach Norddeutschland vor. Vertikale Windscherung (Änderung von Windgeschwindigkeit und -richtung mit der Höhe)
begünstigte langlebige und kräftige Gewitter, auch Superzellen (Gewitter mit rotierendem Aufwind) wurden beobachtet.
In Nordrhein-Westfalen entfachten Blitzeinschläge mindestens drei Brände, der Gesamtschaden belief sich auf ca. eine
halbe Million Euro. In einem Stall verendeten 120 Schweine. In Solingen rückte die Feuerwehr zu über 100 Einsätzen aus, um
vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Auf der Bahnstrecke Aachen - Neuss kollidierte ein Güterzug mit einem umgestürzten
Baum, die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.
|
Radarbilder vom 21./22.07.2009 | Quelle: DWD |
 |
 |
 |
 |
| 21.07.2009, 21 Uhr MESZ |
22.07.2009, 00 Uhr MESZ |
22.07.2009, 03 Uhr MESZ |
22.07.2009, 06 Uhr MESZ |
|
Blitzkarten vom 21./22.07.2009 | Quelle: BLIDS |
 |
 |
 |
 |
| 21.07.2009, 19 bis 21 Uhr MESZ |
21., 22 bis 22.07., 00 Uhr MESZ |
22.07.2009, 01 bis 03 Uhr MESZ |
22.07.2009, 04 bis 06 Uhr MESZ |
An der Grenze zur kühleren Meeresluft im Westen wandelte sich die Kaltfront von "Wolfgang" in eine langgezogene
Luftmassengrenze um, die aufgrund ihrer nahezu höhenströmungsparallelen Lage zunächst kaum südostwärts vorankam und zur
Wellenbildung neigte. Im Vorfeld einer solchen Welle verstärkte sich im Laufe des 22. noch einmal die
Warmluftadvektion; ein daraus resultierender, flacher Rücken dämpfte tagsüber die Gewittertätigkeit vorübergehend. Mit
Passage der Welle kamen in der Nacht zum 23. in der Nordwesthälfte neue Gewitter auf.
Der nochmalige Warmluftvorstoß in Verbindung mit Föhn ließ die Temperaturen im Alpenraum sowie im Alpenvorland sowohl im
850-hPa-Niveau als auch am Boden kräftig steigen. Am 23. um Mittag war in den Karten über Ostösterreich sogar eine
+26-Grad-Blase in 850 hPa verzeichnet - ein für hiesige Breiten extremer Wert. Extrem waren auch die Nachttemperaturen
an einigen für starke Föhneffekte bekannten Stationen. In Altdorf im Schweizer Kanton Uri beispielsweise betrug die
Tiefsttemperatur (!) in der Nacht zum 23. +26,3 °C, ähnlich warm blieb es in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein mit
einem Minimum von +26,1 °C. Hinzu gesellte sich Föhnsturm mit Böen bis 87 km/h im Flachland (Altdorf). Weiter im Osten
setzte sich der Föhn erst in den Frühstunden und am Vormittag durch und überlagerte sich mit der tagesgangbedingten
Erwärmung. So wurden zum Beispiel in München um 10 Uhr MESZ schon +28,2 °C gemessen, bis zum Nachmittag kletterte das
Quecksilber dort bis auf +35,2 °C. Am Flughafen konnte mit einem Höchstwert von +34,7 °C sogar ein neuer
Julirekord gefeiert werden.
Noch etwas heißer mit Temperaturen verbreitet um +35 °C wurde es im Osten Österreichs. Den Spitzenplatz nahm Waidhofen
an der Ybbs in Niederösterreich mit +37,9 °C ein, der Rekord vom Juli 1950 (+39,3 °C) geriet aber nicht in
Gefahr. Neue Rekorde gab es dagegen in Bad Goisern (Oberösterreich, +37,3 °C), in Gmunden (Oberösterreich,
+36,8 °C) und in Zell am See (Salzburg, +35,1 °C).
Nachstehend die höchsten gemessenen Temperaturen in Deutschland im Messnetz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und in
Österreich am 23.07.2009. Quellen: DWD und ZAMG
| Orte Deutschland |
23. |
Mühldorf am Inn (BY)
München/Stadt (BY)
Chieming (BY)
München/Flgh. (BY)
Garmisch-Partenkirchen (BY) |
35,2 °C
35,2 °C
35,0 °C
34,7 °C
34,5 °C |
|
| Orte Österreich |
23. |
Waidhofen an der Ybbs (NÖ)
Bad Goisern (OÖ)
Salzburg-Freisaal (SBG)
Weyer (OÖ)
Gmunden (OÖ) |
37,9 °C
37,3 °C
36,9 °C
36,9 °C
36,8 °C |
|
Von Ostfrankreich her breiteten sich schon am Morgen des 23. im Umfeld einer Konvergenzlinie Schauer und Gewitter nach
Rheinland-Pfalz, Baden und Hessen aus, das konvektiv durchsetzte Regenband erreichte im Laufe des Nachmittags die
Ostseeküste. Im Südwesten folgten weitere Gewitter, die über den Norden Baden-Württembergs, Nordbayern und Thüringen
ostwärts zogen und sich zusammen mit aus den Alpen aufkommenden Gewittern zum Abend über Südpolen und Tschechien zu
einer mehreren hundert Kilometer langen Linie, einer sogenannten "squall line", verbanden. Der Durchzug dieser
Gewitterlinie ging mit schweren Sturm- und Orkanböen einher. In Ústí nad Labem, einer Stadt im Norden
Tschechiens, wurden 122 km/h registriert. Durch umstürzende Bäume starben in Polen sieben Menschen, in Tschechien kam
eine Person ums Leben. An die hundert Menschen wurden verletzt. Der Sturm entwurzelte zahlreiche Bäume, knickte
Strommasten um und deckte ganze Dächer ab.
Weitere Gewitterschwerpunkte waren am Nachmittag und Abend die Schweiz, der Süden Bayerns und in der Nacht zum 24.
auch Österreich. Hagelkörner mit Durchmesser bis 5 cm wurden im Schweizer Kanton Fribourg, noch größere Brocken im
Landkreis Traunstein in Oberbayern und in Oberösterreich beobachtet. Dort sollen sogar einzelne Schlossen mit 10 cm
Durchmesser gefunden worden sein. Zwischen 20 und 23 Uhr MESZ verbuchte der Flughafen Wien/Schwechat eine
115-km/h-Böe, Eisenstadt kam auf 100 km/h. Im niederösterreichischen Tulln wüteten Orkanböen (137 km/h). Auf deutscher
Seite stachen Lahr mit 87 km/h und Heilbronn mit 79 km/h hervor. Im Laufe des Abends gab es an der Luftmassengrenze
selbst dann hauptsächlich über der Mitte Deutschlands nochmals kräftige Gewitter, in Bad Hersfeld (Hessen) fielen 46 mm
in nur sechs Stunden.
Kleinere und größere Schäden wurden aus fast allen deutschen Landesteilen gemeldet. In Baden-Württemberg erwischte es am
Nachmittag besonders heftig den Ortenaukreis und die Rheintalautobahn zwischen Achern und Bühl, wo mehrere umgestürzte
Bäume für Behinderungen und lange Staus sorgten. In Passau wurden zwei Menschen leicht verletzt, als im Hafen ein
Aluminiumdach weggerissen wurde und auf Booten und Fahrzeugen landete. Blitzeinschläge verursachten unter anderem in
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Brände und hohe Schäden. In Niederösterreich entstanden allein in der
Landwirtschaft Schäden von rund drei Millionen Euro. Fast 4.000 Feuerwehrmänner waren dort die Nacht über im Einsatz.
Am 24. verlagerten sich die Luftmassengrenze und mit ihr die schweren Gewitter nach Osteuropa. In Minsk, der Hauptstadt
Weißrusslands, fielen innerhalb von zwölf Stunden 56 mm Regen. In der rückseitig einfließenden, mäßig warmen Meeresluft
entwickelten sich im Bereich des langsam durchschwenkenden Hauptteil des Höhentroges aber auch in der Mitte und im Norden
Deutschlands nochmals kurze, kräftige Gewitter. Dabei traten örtlich Sturmböen auf (z. B. Hannover/Flgh. 76 km/h).
Wetterwerte
Nachstehend die jeweils fünf größten 24-stündigen Niederschlagsmengen in Deutschland im Messnetz des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) bis zum 22., 23. und 24.07.2009 (jeweils 06 UTC) sowie die stärksten Böen in Österreich vom
23./24.07.2009. Quellen: DWD und ZAMG
| Ort |
21./22. |
Salzkotten (NRW)
Osnabrück (NDS)
Mönchengladbach-Hilderath (NRW)
Großenlüder-Kleinlüder (HE)
Dinslaken (NRW)
Rheinstetten (BW) |
36 mm
33 mm
29 mm
29 mm
29 mm
0 mm |
|
| Ort |
22./23. |
Groß Berßen (NDS)
Bockhorn-Grabstede (NDS)
Glücksburg-Meierwik (SH)
Krempel (SH)
Emden (NDS)
Rheinstetten (BW) |
53 mm
47 mm
47 mm
46 mm
40 mm
<1 mm |
|
| Ort |
23./24. |
Bad Hersfeld (HE)
Großenlüder-Kleinlüder (HE)
Petersberg-Marbach (HE)
Jachenau-Tannern (BY)
Geisa (TH)
Rheinstetten (BW) |
52 mm
47 mm
43 mm
41 mm
38 mm
8 mm |
|
| Ort |
23./24. |
Tulln (NÖ)
Zwerndorf-Marchegg (NÖ)
Wien/Flgh. (W)
Enns (OÖ)
Leiser Berge (NÖ) |
137 km/h
131 km/h
115 km/h
114 km/h
113 km/h |
|
Niederschlag/Gewitter
 |
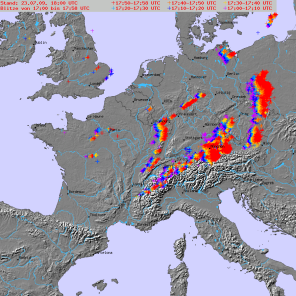 |
Radaranimation vom 23.07., 06:00 MESZ bis 24.07., 06:00 MESZ
in 15-min-Schritten /
Größe ca. 4 MB | Quelle der Bilder: DWD |
Blitze in Europa am 23.07.2009, 17:00 bis 17:58 UTC.
Quelle: DWD |
 |
Amateurvideo eines Hagelunwetters in Altenmarkt (Oberbayern)
am 23.07.2009 /
Größe ca. 5 MB | Quelle: YouTube |
Satellitenbilder
 |
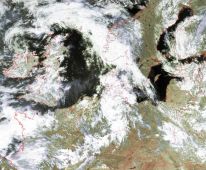 |
21.07., 16:30 UTC, NOAA-15 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
22.07., 12:15 UTC, NOAA-18 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
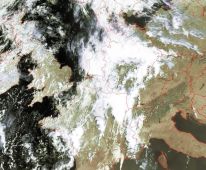 |
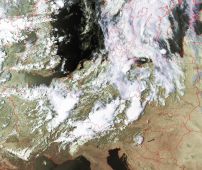 |
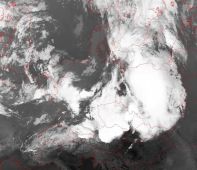 |
23.07., 10:13 UTC, NOAA-17 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
23.07., 15:42 UTC, NOAA-15 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
23.07., 19:57 UTC, NOAA-17 IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
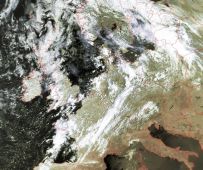 |
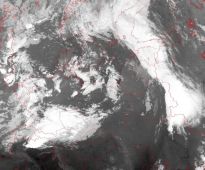 |
24.07., 09:49 UTC, NOAA-17 VIS/IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
24.07., 19:34 UTC, NOAA-17 IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
Text: CE

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|

