Wetterlage und Entwicklung
Eine niederschlagsreiche Witterungsperiode, die in Teilen der Schweiz und Deutschland großflächige Überflutungen zur Folge
hatte und am Rhein für Hochwasser sorgte, stellte sich vom 6. bis 11. August 2007 über Mitteleuropa ein. Wie nicht selten
bei Starkniederschlagsereignissen zu beobachten ist, war auch in diesem Fall die Beständigkeit der Wetterlage und damit eine
Quasistationarität von relevanten synoptischen Strukturen ausschlaggebend für das Zustandekommen teilweise enormer
Niederschlagsmengen im westlichen Alpenraum und in der Südhälfte Deutschlands.
Ihren Anfang nahm diese brisante Wetterlage, die in ihrer großräumigen Struktur etwa eine Woche lang andauerte, am 05./06.08.
Das bis dahin im zentralen Europa wetterbestimmende Hochdruckgebiet "Ezalda" verlagerte seinen Schwerpunkt von
Ostdeutschland nach Finnland. Von Westen näherte sich ein langwelliger Höhentrog dem europäischen Kontinent, der am 7. um
00 UTC vom Nordmeer über Großbritannien nach Südwesteuropa reichte. Darin eingebettet befand sich Tiefdruckgebiet "Karlheinz"
über dem Norden Schottlands. Seine Kaltfront erstreckte sich zu diesem Zeitpunkt über die Nordsee, Benelux und Ostfrankreich
südwestwärts. Auf der Vorderseite des gesamten Systems wurde Warmluft subtropischen Ursprungs nach Nordosten transportiert.
Innerhalb dieser Luftmasse bildete sich im Vorfeld der Kaltfront, einhergehend mit einer flachen Bodentiefdruckrinne, eine
Konvergenzlinie aus. Reste dieser Konvergenzlinie konnten am 7. über dem Osten Deutschlands im Windfeld identifiziert werden,
aus der Tiefdruckrinne entstand über Tschechien das Tief "Leander". Die Kaltfront kam etwa bis zur Mitte Deutschlands,
anschließend aber kaum mehr nach Osten voran.
Aus dem westeuropäischen Langwellentrog schnürte sich derweil über Großbritannien ein Höhentief ab, das mit seinem Zentrum
über die Mitte Frankreichs bis zum 9. nach Oberitalien zog. Unter seiner Vorderseite entwickelte sich an dem Frontenzug im
Bereich des Löwengolfs ein neues kleines Tief, das nach Nordosten wanderte und am 9. zusammen mit dem ursprünglichen Tief
über Tschechien/Ostdeutschland nun als Tiefdruckgebiet "Leander" analysiert wurde. Als Folge der Lage von Höhen- und
Bodentief ergab sich nun eine beachtliche vertikale Windscherung: An der Nord- und Westflanke von "Leander" strömte die
immer noch über dem Osten Deutschlands liegende Warmluft wieder nach Westen und Süden, wo sie über die dort eingeflossene,
recht kalte Atlantikluft gehoben wurde. In höheren Schichten der Troposphäre war auf der Ostseite des Höhentiefs dagegen
eine südliche Strömung vorherrschend.
Zu Beginn des Zeitraumes konnten verschiedene Aktivitätszonen abgegrenzt werden, die in der Folge immer mehr verschmolzen.
Zum einen setzten zunächst in der Schweiz mit der Annäherung des Höhentiefs ab dem Abend des 7. intensive Regenfälle ein,
die bis zum 9. andauerten. Dieser Regen breitete sich in der Nacht zum 8. nach Südwestdeutschland und am 8. tagsüber bis zur
Mitte des Bundesgebietes aus, wo es bereits entlang der Luftmassengrenze in einem Streifen vom Niederrhein über Südhessen
bis ins westliche Bayern regnete. Am Abend des 8. und in der Nacht zum 9. kamen im südlichen Baden-Württemberg erneut
Niederschläge auf. Durch die beginnende Warmluftadvektion verstärkten sich am 9. auch die Regenfälle an der nun eher quer
ausgerichteten Luftmassengrenze vom Niederrhein über den Mittelgebirgsraum ostwärts. Am 10. und 11. waren hauptsächlich
noch Baden-Württemberg und Bayern von länger anhaltenden Regenfällen betroffen, ehe diese mit nachlassender Warmluftadvektion
und dem Abzug des Tiefdrucksystems nach Osten auch dort nachließen.
Die Nordosthälfte Deutschlands merkte von all dem wenig - dort waren dafür kräftige Gewitter ein Thema, die sich dort
innerhalb der Warmluft mit Unterstützung des Tagesgangs entwickelten. Zum Beispiel fielen am Flughafen Berlin-Tegel am 8.
binnen weniger Stunden 34 mm. Am 10. wirkte sich auch im Norden und Osten das sich etwas nach Norden ausweitende Höhentief
in Form einer Verstärkung der konvektiven Prozesse aus. So ist es zu erklären, dass eine private Wetterfirma auf der
Ostseeinsel Fehmarn am 11. eine 24-stündige Niederschlagsmenge von 176 mm registrierte, die das Resultat mehrerer kräftiger
Schauer war.
Wie sehr häufig bei Schauern und Gewittern war auch diese enorme Summe lokal sehr begrenzt. Die Station des Deutschen
Wetterdienstes in Westermarkelsdorf erfasste im gleichen Zeitraum lediglich 17 mm. Auch die aus diesen Regionen gemeldeten
Überschwemmungen traten nur dort auf, wo kurz zuvor ein starkes Gewitter über einen Ort oder eine Stadt hinweg zog
(z.B. in Hamburg). Diese Überschwemmungen waren aber nicht mit der flächenhaften Hochwassersituation in der Schweiz sowie
im Süden und Westen Deutschlands zu vergleichen.
Die Hochwasserwelle des Rheins wurde in erster Linie durch die heftigen Regenfälle in der Schweiz hervorgerufen. Dort
gingen in rund 48 Stunden verbreitet zum Teil deutlich über 100 mm nieder. Hinzu kamen große Niederschlagsmengen am Hochrhein
und in Südbaden (z.B. Feldberg/Schwarzwald 66 mm in 48 Stunden). Aber auch im Westen Deutschlands führten starke
Niederschläge (z.B. Düsseldorf/Flgh. 54 mm in 48 Stunden) an einigen Flüssen (z.B. an der Ruhr) zu erhöhten
Wasserständen.
Allein in der Schweiz richtete das Hochwasser nach Medienberichten einen Schaden von umgerechnet mehr als 120 Millionen Euro
an. Zahlreiche Häuser am Bielersee und in Laufen, wo der Fluss Birs über die Ufer trat, wurden überschwemmt. In
Südwestdeutschland war vor allem der Landkreis Waldshut-Tiengen betroffen. Dort standen u.a. Sportplätze und ein Campingplatz
unter Wasser. Am Pegel Karlsruhe-Maxau erreichte der Rhein am Abend des 10. mit 8,57 m seinen Höchststand, was aber nicht an
alte Rekordmarken (z.B. 8,83 m im Mai 1999) heranreichte. Eine größere Gefahr bestand nicht, lediglich die Rheinauen wurden
überflutet. Rückhaltebecken mussten nicht geöffnet, die Schifffahrt allerdings eingestellt werden.
Viel Regen gab es auch in Österreich. In Bregenz am Bodensee fielen 118 mm in 48 Stunden; in Niederösterreich infolge von
Gewittern am Abend des 9. bis 52 mm in 24 Stunden (Wien-Unterlaa). Am Wiener Flughafen konnten Flugzeuge wegen überschwemmter
Flugsteige und starken Regens zeitweise nicht starten, es kam zu etwa 70 Verspätungen.
Text: CE
Bodendruckanalysen vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC
Quelle: FU Berlin / DWD
|
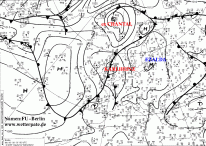 |
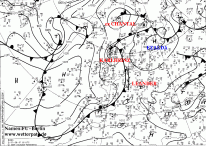 |
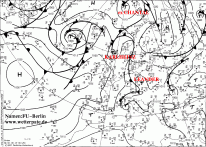 |
| 06.08.2007, 00 UTC |
07.08.2007, 00 UTC |
08.08.2007, 00 UTC |
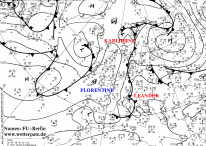 |
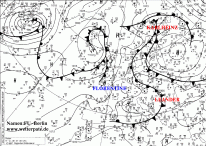 |
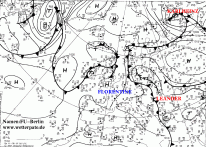 |
| 09.08.2007, 00 UTC |
10.08.2007, 00 UTC |
11.08.2007, 00 UTC |
500 hPa-Geopotential und Bodendruck vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC
Quelle: Wetterzentrale
|
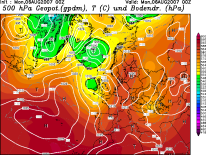 |
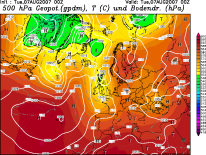 |
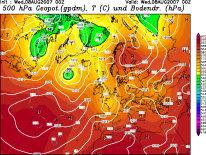 |
| 06.08.2007, 00 UTC |
07.08.2007, 00 UTC |
08.08.2007, 00 UTC |
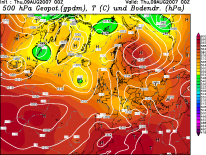 |
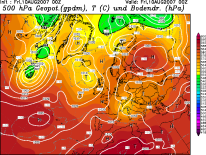 |
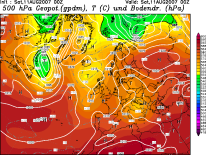 |
| 09.08.2007, 00 UTC |
10.08.2007, 00 UTC |
11.08.2007, 00 UTC |
850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC
Quelle: Wetterzentrale
|
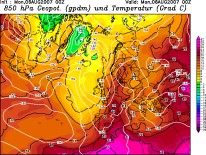 |
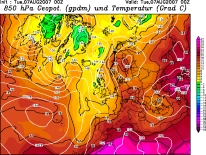 |
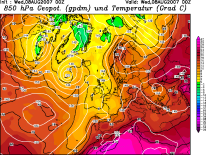 |
| 06.08.2007, 00 UTC |
07.08.2007, 00 UTC |
08.08.2007, 00 UTC |
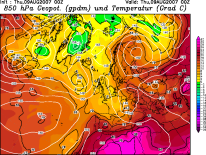 |
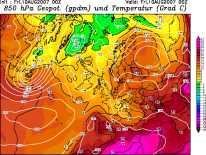 |
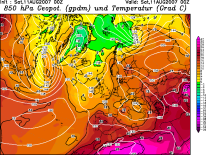 |
| 09.08.2007, 00 UTC |
10.08.2007, 00 UTC |
11.08.2007, 00 UTC |
Wetterwerte
Nachstehend ausgewählte 24-stg. Niederschlagsmengen aus Deutschland vom 06.-12.08.2007
sowie aus der Schweiz (jeweils 12-stg. bis zum Termin) im Zeitraum 06.-10.08.2007 (Quellen: DWD, WetterOnline):
| Ort |
6./7. |
7./8. |
8./9. |
9./10. |
10./11. |
11./12. |
Summe |
Hamburg/Flgh.
Oldenburg
Berlin-Tegel/Flgh.
Bad Lippspringe
Wittenberg
Düsseldorf/Flgh.
Lüdenscheid
Chemnitz
Würzburg
Karlsruhe
Stuttgart/Flgh.
Lahr
Freiburg
Feldberg/Schw.
Sigmaringen
München/Stadt
Konstanz
Hohenpeißenberg |
-
-
-
-
-
1 mm
1 mm
-
-
3 mm
-
13 mm
11 mm
-
-
-
-
- |
-
52 mm
-
2 mm
38 mm
3 mm
10 mm
-
8 mm
13 mm
4 mm
15 mm
18 mm
25 mm
42 mm
34 mm
38 mm
72 mm |
12 mm
1 mm
34 mm
12 mm
-
17 mm
33 mm
25 mm
38 mm
16 mm
11 mm
20 mm
31 mm
41 mm
25 mm
14 mm
46 mm
20 mm |
-
-
-
58 mm
-
37 mm
45 mm
42 mm
13 mm
20 mm
5 mm
9 mm
7 mm
5 mm
1 mm
1 mm
-
1 mm |
5 mm
-
-
-
-
-
-
6 mm
1 mm
11 mm
13 mm
1 mm
3 mm
7 mm
k.M.
8 mm
6 mm
8 mm |
5 mm
-
23 mm
-
1 mm
-
-
13 mm
-
-
-
-
2 mm
-
k.M.
37 mm
2 mm
7 mm |
22 mm
53 mm
57 mm
72 mm
39 mm
58 mm
89 mm
86 mm
60 mm
63 mm
33 mm
58 mm
72 mm
78 mm
68 mm
94 mm
92 mm
108 mm |
|
| Ort |
6.,
18 UTC |
7.,
06 UTC |
7.,
18 UTC |
8.,
06 UTC |
8.,
18 UTC |
9.,
06 UTC |
9.,
18 UTC |
10.,
06 UTC |
Summe |
Grand St. Bernard (CH)
Chasseral (CH)
Plaffeien (CH)
Wädenswil (CH)
Hörnli (CH)
Buchs (CH)
Napf (CH)
Lausanne/Pully (CH)
Luzern (CH)
Zürich-Kloten/Flgh. (CH)
St. Gallen (CH)
Bern (CH)
Basel-Flgh. (CH) |
-
-
-
-
-
-
10 mm
-
-
-
-
-
- |
2 mm
40 mm
12 mm
-
5 mm
-
2 mm
4 mm
-
-
-
k.M.
12 mm |
10 mm
5 mm
1 mm
14 mm
8 mm
11 mm
7 mm
k.M.
19 mm
4 mm
5 mm
-
12 mm |
6 mm
13 mm
32 mm
61 mm
46 mm
6 mm
30 mm
21 mm
31 mm
19 mm
55 mm
9 mm
10 mm |
46 mm
39 mm
43 mm
30 mm
18 mm
28 mm
36 mm
21 mm
30 mm
14 mm
6 mm
42 mm
16 mm |
73 mm
55 mm
35 mm
33 mm
59 mm
54 mm
36 mm
48 mm
26 mm
69 mm
42 mm
38 mm
43 mm |
31 mm
13 mm
18 mm
1 mm
3 mm
8 mm
13 mm
25 mm
5 mm
3 mm
-
13 mm
5 mm |
1 mm
1 mm
1 mm
-
-
31 mm
1 mm
3 mm
-
-
-
-
- |
169 mm
166 mm
142 mm
139 mm
139 mm
138 mm
135 mm
122 mm
111 mm
109 mm
108 mm
102 mm
98 mm |
|
Niederschlag
Zeitlicher Verlauf des Rheinpegels an der
Station Karlsruhe-Maxau
Quelle: HVZ Baden-Württemberg
|
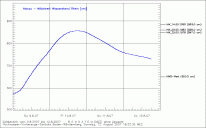 |
(Die Uhrzeitangaben auf den nachstehenden Radarbildern sind falsch. Statt "MEZ" muss es "MESZ" heißen.)
Radarbilder vom 06.08. bis 11.08.2007
Quelle: wetter.com
|
 |
 |
 |
| 06.08.2007, 20 UTC |
07.08.2007, 23 UTC |
08.08.2007, 18 UTC |
 |
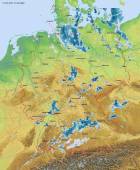 |
 |
| 09.08.2007, 15 UTC |
10.08.2007, 21 UTC |
11.08.2007, 15 UTC |
Satellitenbilder
 |
 |
 |
06.08., 12:54 UTC, NOAA-18 IR/VIS
Quelle: B. J. Burton |
07.08., 12:20 UTC, AQUA VIS
Quelle: NASA Earth Laboratory |
08.08., 16:16 UTC, NOAA-12 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
 |
 |
 |
09.08., 12:12 UTC, NOAA VIS
Quelle: DLR |
10.08., 16:28 UTC, NOAA-15 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
11.08., 12:04 UTC, NOAA-18 IR/VIS
Quelle: B. J. Burton |

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|

