Wetterlage und Entwicklung
Reichlich Interessantes bot das Wetter in der Woche vom 17. bis zum 24. März 2007
vielen Gebieten Mittel- und Südeuropas. Für Schlagzeilen sorgten vor allem intensive
Niederschläge, die in der Mitte und im Süden Deutschlands teilweise als Schnee fielen
und ausgerechnet zum astronomischen Frühlingsbeginn den Winter zurückbrachten.
Eine Tiefdruckentwicklung bei Neufundland leitete diese turbulente Woche ein. Das Tief
erhielt den Namen "Orkun" und war am Mittag des 17. südlich von Island zu analysieren.
Auf der Vorderseite eines von Nordwesten heranschwenkenden Höhentroges befand es sich im
Bereich kräftiger Advektion von positiver, mit der Höhe zunehmender Vorticity. Unter diesen
günstigen Voraussetzungen vertiefte es sich rasch weiter. Am 18. um 12 UTC hatte "Orkun" als
Orkantief die Küste Südwestnorwegens erreicht und wies nach einem Druckfall von etwa 35 hPa
binnen 24 Stunden einen Kerndruck von weniger als 950 hPa auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte
die Kaltfront des Tiefs den Nordwesten Deutschlands bereits überquert und verlief etwa von
der Ostsee über die Mitte der Bundesrepublik und Nordfrankreich zur Bretagne. Mit ihr
verbunden waren häufig mäßige Regenfälle. Mit Annäherung von "Orkun" verschärften sich auch
die Luftdruckgegensätze. Bereits in der Nacht zum 18., innerhalb des Warmsektors, traten
hauptsächlich an der Nordseeküste sowie auf den Bergen Sturm- und schwere Sturmböen auf
(z.B. Helgoland/Düne 90 km/h). Mit Passage der Front und in der danach schrittweise
einfließenden hochreichenden Kaltluft polaren Ursprungs kam es an der Nordseeküste und auf
den Bergen verbreitet zu orkanartigen Böen der Stärke 11, in List/Sylt wurde mit 126 km/h
sogar eine Orkanböe registriert. Aber auch im flachen Binnenland wehte der Wind mit Böen
in Sturmstärke, vereinzelt auch darüber (z.B. Chemnitz 101 km/h).
Zu schweren Sturm- und Orkanböen durch "Orkun" war es bereits am 18. in Großbritannien und
in Skandinavien gekommen (z.B. Foula/Shetland Inseln 152 km/h, Utsira/Norwegen 119 km/h).
In der Nacht zum 19. verließ die Kaltfront Deutschland Richtung Südosten. "Orkun" hatte den
Höhepunkt seiner Entwicklung überschritten und übernahm bei Skandinavien vorübergehend die
Rolle eines steuernden Zentraltiefs, zog aber schon am 21. rasch mit dem nördlichen Teil des
sich in zwei Teile aufspaltenden Höhentroges nach Norden ab. Der südliche Teil des Troges führte
im westlichen Mittelmeerraum Regie. Im Lee der Alpen und durch Interaktion mit dem Trog entstand
über Oberitalien das Tief "Paul". Es brachte in erster Linie dem Südosten Österreichs sowie auf
dem Balkan intensive Regen- und Schneefälle, die örtlich von Blitz und Donner begleitet waren.
In Ratece/Planica (Slowenien, 865 m) fielen binnen eines Tages bis zum 20., 6 UTC 58 cm Neuschnee.
Aber auch aus Österreich (St. Michael im Lungau, 1094 m) und aus Italien (Tarvisio, 778 m) wurden
24-stündige Neuschneemengen von 51 cm bzw. 48 cm gemeldet. Entsprechend hoch waren auch die
24-stündigen Niederschlagsmengen bis zu diesem Termin. Spitzenreiter war Klagenfurt/Flgh. (Österreich)
mit 65 l/m², wobei ein Teil davon als Schnee niederging. Die Schneehöhe betrug am Morgen dort 24 cm.
In Kärnten und der Steiermark kam es infolge der starken Schneefälle zu erheblichen Behinderungen.
Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken waren unpassierbar oder wurden wegen akuter Lawinengefahr gesperrt.
Zudem fiel in 40.000 Haushalten der Strom aus.
Noch am 20. dehnte sich "Paul" nach Nordosten aus. Dabei bildete sich über dem östlichen Mitteleuropa
ein zweiter Tiefkern, der "Paul II" genannt wurde. Das ursprüngliche Tiefzentrum verblieb unter leichter
Verlagerung nach Süden über Italien und wurde nun als "Paul I" bezeichnet. "Paul I" löste in Verbindung
mit der im 500 hPa-Niveau bis unter -35 °C kalten Luft rund um das Tyrrhenische Meer am 20. kräftige
Schauer und Gewitter aus. Bis zum 21., 6 UTC regnete es z.B. in Monte Scuro (Italien) 24-stündig 55 l/m².
Aber auch weiter östlich, in Griechenland und erneut auf dem Balkan, kamen einmal mehr hohe
Niederschlagssummen zustande. Dort, an der Grenze zu warmer Luft subtropischen Ursprungs war die
Vorderseite des Troges wirksam, an der immer wieder kurzwellige Anteile nach Nordosten abliefen und
Hebungsantriebe lieferten. Die höchste Menge verbuchte dabei Nikšic (Montenegro) mit 103 l/m² in
24 Stunden bis zum 21., 6 UTC. Auch an den Folgetagen setzten sich die zum Teil ergiebigen Niederschläge
in diesen Regionen fort (z.B. Skyros/Airport (Griechenland) 101 l/m² vom 22., 6 UTC bis zum 23., 6 UTC).
Diese standen dann auch im Zusammenhang mit dem Tief "Quentin", das sich am 22. an der Luftmassengrenze gebildet hatte.
Für Mitteleuropa entscheidend wurde ab dem 21. immer mehr das Tief "Paul II". Kräftige Warmluftadvektion
auf der Ost- und Nordflanke dieses Tiefs erfasste zuerst den Osten und Norden Deutschlands und sorgte dort
für Regen- und Schneefälle. Bis zum Morgen des 22. wurden an einigen Stationen hauptsächlich im ostdeutschen
Raum einige Zentimeter Neuschnee beobachtet (z.B. Potsdam 4 cm). Am 22. und 23. wanderte "Paul II" unter
langsamer Auffüllung quer über Deutschland hinweg Richtung Nordostfrankreich, wo es sich schließlich auflöste.
Dabei griffen von Norden her kräftige Niederschläge auch auf die Mitte und den Südwesten des Landes über,
Bayern wurde weitestgehend ausgespart. In der Nacht zum 23. schneite es dabei bis in die Niederungen,
selbst in Karlsruhe lagen am Morgen 2 cm Schnee. Zu einem solch späten Termin hatte man dort zuletzt
vor 34 Jahren eine geschlossene Schneedecke in die Aufzeichnungsbücher eintragen können. Bis zum Abend blieb
von dieser Schneedecke aber aufgrund der sich auch durch eine dichte Wolkendecke hindurch bemerkbar machenden,
kräftigen Märzsonne nichts mehr übrig. Viel Schnee gab es in den südwestdeutschen Mittelgebirgen. Am Mummelsee
im Schwarzwald auf 1042 Meter Höhe verzeichnete eine private Wetterfirma 80 cm Schnee, selbst auf dem nur 567 Meter
hohen Königstuhl bei Heidelberg lagen nach Augenzeugenberichten 30 bis 40 cm Schnee. Die starken Schneefälle
führten vielerorts zu Verkehrsbehinderungen. Teilweise staute sich der Verkehr auf den Autobahnen bis auf
20 Kilometer Länge. Es ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Im Enzkreis kam dabei ein Mann ums Leben.
Auch der Schienen- und Flugverkehr war vom Wintereinbruch betroffen. In Thüringen musste die Deutsche Bahn
einige Strecken sperren, nachdem Bäume unter der Schneelast umgestürzt waren. Im Großraum Stuttgart blieben
viele S-Bahnen stehen, weil Äste auf den Oberleitungen Kurzschlüsse auslösten. Eine S-Bahn mit etwa 100 Fahrgästen
blieb in einem Tunnel stecken und wurde von einer Diesellok abgeschleppt. Am Stuttgarter Flughafen musste
die einzige Start- und Landebahn für 40 Minuten wegen Räumungsarbeiten geschlossen werden.
Dagegen konnten sich die Skifahrer über den unerwartet vielen Neuschnee freuen. Nicht nur im Nordschwarzwald
öffneten nochmals zahlreiche Lifte, für die Langläufer wurden Loipen gespurt.
Am 24. zog das kaum noch als solches zu erkennende Tief "Quentin" über Süddeutschland hinweg nach Westen.
Am Vormittag schneite es erneut bis in die Niederungen, doch ging dort der Schnee bald in Regen über.
Nennenswerten Neuschnee lieferte dieses Tiefdruckgebiet jedoch auch in den Höhenlagen nicht mehr.
Mit "Quentin" endete der Einfluss des sich inzwischen zum Höhentief umgewandelten Troges, dessen Vorstoß
knapp eine Woche zuvor diese Ereignisse initiiert hatte. Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien bestimmte
vom 25. an das Wetter in Deutschland. Von Südosten wurde dabei trockenere und zunehmend mildere Luft advehiert,
sodass der Frühling vier Tage nach dem kalendarischen Beginn auch in der Realität starten konnte.
Text: BM, CE
Bodendruckanalysen vom 17. bis 24.03.2007, jeweils 00 UTC
Quelle: FU Berlin / DWD
|
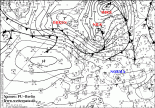 |
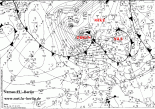 |
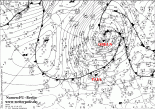 |
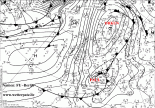 |
| 17.03.2007, 00 UTC |
18.03.2007, 00 UTC |
19.03.2007, 00 UTC |
20.03.2007, 00 UTC |
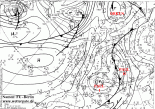 |
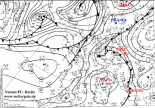 |
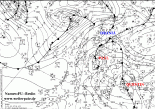 |
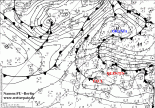 |
| 21.03.2007, 00 UTC |
22.03.2007, 00 UTC |
23.03.2007, 00 UTC |
24.03.2007, 00 UTC |
850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 17.-24.03.2007
jeweils 00 UTC
Quelle: Wetterzentrale
|
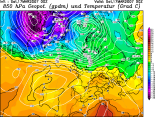 |
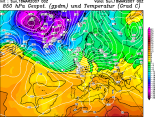 |
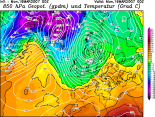 |
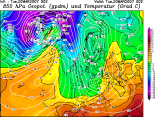 |
| 17.03.2007, 00 UTC |
18.03.2007, 00 UTC |
19.03.2007, 00 UTC |
20.03.2007, 00 UTC |
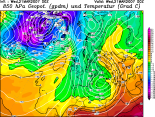 |
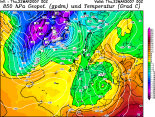 |
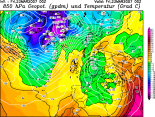 |
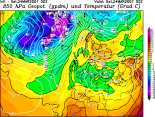 |
| 21.03.2007, 00 UTC |
22.03.2007, 00 UTC |
23.03.2007, 00 UTC |
24.03.2007, 00 UTC |
Wetterwerte
Nachstehend eine Auswahl gemessener Spitzenböen in Deutschland
vom 18.03.2007, eine Auswahl 24-stündiger Niederschlagsmengen in
Europa (jeweils von 06 bis 06 UTC) sowie einige Schneehöhen in
Deutschland vom 23.03.2007, 06 UTC:
| Ort |
Böe, 18.03. |
Brocken
List/Sylt
Fichtelberg
Wendelstein
Boltenhagen
St. Peter-Ording
Feldberg/Schw.
Zugspitze
Hohenpeißenberg
Alte Weser Leuchtturm |
140 km/h
126 km/h
126 km/h
119 km/h
115 km/h
112 km/h
112 km/h
112 km/h
108 km/h
108 km/h |
|
| Ort |
19./20. |
20./21. |
21./22. |
22./23. |
23./24. |
Summe |
Klagenfurt/Flgh. (A)
Monte Scuro (I)
Triest (I)
Mostar (BIH)
Nikšić (MTN)
Podgorica (MTN)
Ulcinj (MTN)
Çanakkale (TRK) |
65 mm
21 mm
63 mm
26 mm
43 mm
3 mm
-
-
|
-
55 mm
3 mm
15 mm
103 mm
90 mm
73 mm
- |
-
25 mm
-
28 mm
40 mm
10 mm
20 mm
85 mm
|
-
2 mm
-
15 mm
4 mm
-
-
47 mm
|
8 mm
9 mm
-
-
4 mm
1 mm
3 mm
7 mm
|
73 mm
112 mm
66 mm
84 mm
194 mm
104 mm
96 mm
139 mm
|
|
| Ort |
Schneehöhe,
23.03. |
Brocken
Feldberg/Schw.
Fichtelberg
Kahler Asten
Wasserkuppe
Neuhaus am Rennweg
Weinbiet/Pfälzer Wald
Freudenstadt
Stötten/Schw. Alb
Vielbrunn/Odenwald
Niederstetten
Öhringen
Messstetten
Sigmaringen
Stuttgart/Echterdingen
Würzburg
Karlsruhe |
91 cm
54 cm
53 cm
36 cm
34 cm
30 cm
26 cm
18 cm
18 cm
17 cm
16 cm
15 cm
14 cm
8 cm
4 cm
2 cm
2 cm |
|
Niederschlag
Niederschlagsmengen
Quelle: HVZ
|
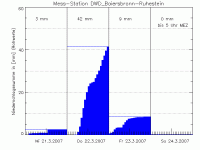 |
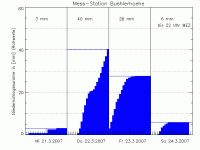 |
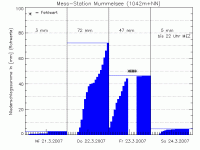 |
| Baiersbronn-Ruhestein |
Bühlerhöhe |
Mummelsee |
Radarbilder vom 22. und 23.03.2007
Quelle: DWD / wetter.com
|
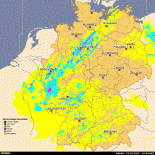 |
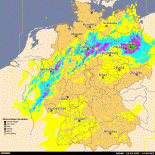 |
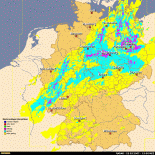 |
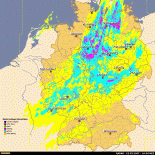 |
| 22.03.2007, 06 UTC |
22.03.2007, 09 UTC |
22.03.2007, 12 UTC |
22.03.2007, 15 UTC |
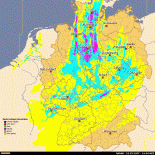 |
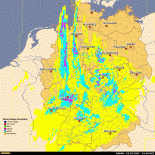 |
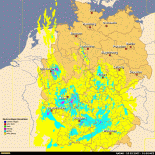 |
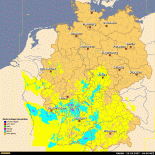 |
| 22.03.2007, 18 UTC |
22.03.2007, 21 UTC |
23.03.2007, 00 UTC |
23.03.2007, 03 UTC |
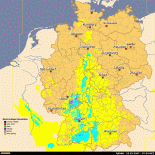 |
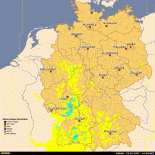 |
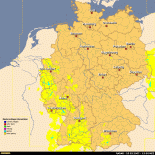 |
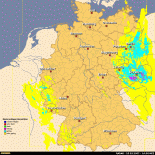 |
| 23.03.2007, 06 UTC |
23.03.2007, 09 UTC |
23.03.2007, 12 UTC |
23.03.2007, 15 UTC |
Satellitenbilder
 |
 |
 |
17.03., 12:00 UTC, MSG-1 VIS
Quelle: B. J. Burton |
18.03., 12:00 UTC, MSG-1 VIS
Quelle: B. J. Burton |
19.03., 16:20 UTC, N12 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
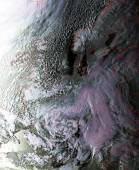 |
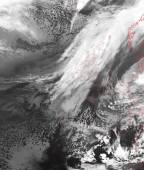 |
 |
20.03., 15:55 UTC, N12 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
21.03., 17:10 UTC, N12 IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
22.03., 16:46 UTC, N12 IR
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
 |
 |
23.03., 16:21 UTC, N12 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
24.03., 15:56 UTC, N12 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|

