Wetterlage und Entwicklung
2006 erlebte Deutschland den wärmsten
Herbst seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen im Jahre
1901. Die durchschnittliche mittlere Temperatur von +12,0 °C überbot
das Mittel der Jahre 1961 bis 1990 um 3,2 K. Dabei führten Südwestlagen
überdurchschnittlich häufig milde Luft subtropischen Ursprungs nordostwärts.
Gut eine Woche, nachdem bundesweit
verbreitet neue Rekorde der Tageshöchsttemperatur für die zweite Novemberdekade
erzielt wurden
(siehe Artikel),
stiegen die Temperaturen am 25. und 26.11.
erneut auf Spitzenwerte über +20 °C. Rekorde für die letzte Novemberdekade
vermeldeten hauptsächlich Stationen in Nordwestdeutschland.
Am 23.11. lag Deutschland auf der Vorderseite
eines weite Teile des Atlantiks sowie ganz Westeuropa überdeckenden
Langwellentroges. In diesen Trog eingebettet befand sich am Boden ein
steuerndes Tiefdrucksystem mit Zentren südwestlich von Island sowie
nördlich von Schottland. Verbunden mit einem Vorstoß höhenkalter
Luft (z.T. unter –40 °C im 500 hPa-Niveau) lief bei Neufundland ein
kurzwelliger Randtrog nach Südosten ab und regenerierte den Langwellentrog
von Westen her. Dieser weitete sich daraufhin nach Süden aus und reichte
am 25. bis zu den Kanarischen Inseln. Über West- und Mitteleuropa hatte
dieser Vorgang ein Drehen der Höhenströmung auf Südwest zur Folge.
Die nach Nordosten ziehende Warmfront des Tiefs mit Kern nördlich von Schottland
leitete im Tagesverlauf des 23. den Warmlufttransport ein. Bereits am
24. konnten somit Höchsttemperaturen von verbreitet +10 °C bis +15°C,
- in Baden-Württemberg auch darüber - gemessen werden. Spitzenreiter
war Freiburg mit +19 °C.
Eine weitere Entwicklung nahm am selben
Tag südwestlich der Britischen Inseln ihren Anfang. Dort entstand am
Südrand des Tiefdrucksystems aus einer Wellenstörung ein eigenständiges
Tiefdruckgebiet, das am 25. weiter nach Nordosten gesteuert wurde und
am frühen Morgen des 26. vor der Küste Norwegens zu analysieren war.
An der Südostflanke dieses Tiefs verschärfte sich in allen Höhenschichten
der Gradient, so dass sich die Warmluftzufuhr aus Südwesten noch verstärkte.
Auf deren Höhepunkt betrug die Temperatur am 25. im 850 hPa-Niveau
über Süddeutschland föhnunterstützt teilweise +15 °C.
Ein am Vormittag des 25. über den
Norden und die Mitte Deutschlands hinwegziehendes Maximum der Vorticity-Advektion
in 500 hPa sowie die Nähe zu der zu diesem Zeitpunkt quer über Frankreich
verlaufenden Kaltfront des Tiefs sorgten in der kompletten Nordwesthälfte
des Landes den ganzen Tag über für meist leichten Regen. Dennoch wurden
dort mit Windunterstützung (verbreitet Böen der Stärke 7) flächendeckend
Temperaturen von deutlich über +15 Grad erreicht und damit an zahlreichen
Orten neue Dekadenrekorde aufgestellt (z.B. Köln/Bonn +18,5 °C, Kalkar
+18,2 °C, Düsseldorf +18,1 °C, Oldenburg +17,1 °C). Vor allem an
der Nordseeküste lagen diese z.T. mehr als 3 K über den bisherigen
Rekorden (z.B. Bremerhaven +16,5 °C; alter Rekord +13,2 °C aus dem
Jahr 2000 und Norderney +15,6 °C; alter Rekord +12,6 °C ebenfalls
aus dem Jahr 2000). Die höchste Temperatur an diesem Tag in Deutschland
konnte in Müllheim bei Freiburg mit +21,8 °C gemessen werden. Auf
knapp +20 °C kamen im Südwesten auch Emmendingen-Mundingen (bei Freiburg),
Baden-Baden-Geroldsau (jeweils +19,5 °C) sowie Sigmarszell-Zeisertsweiler
und Freiburg (je +19,4 °C). In Karlsruhe betrug die Höchsttemperatur
+15,8 °C. Ungewöhnliche Wärme erlebten föhnbedingt auch die Gebiete
nahe der Alpen. In Oberstdorf kletterte das Quecksilber auf +21,3 °C,
was auch für diese Station einen neuen Dekadenrekord bedeutete. Garmisch-Partenkirchen
meldete +18,7 °C, der 986 Meter hohe Hohenpeißenberg +18,0 °C . Im
nur wenige Kilometer entfernten Feldkirch (Österreich) wurde es gar
+22,7 °C warm. Ebenfalls beachtlich waren die Werte einiger weiterer
Bergstationen: Der Weinbiet im Pfälzer Wald (557 m, +16,0 °C) knackte
den bisherigen Dekadenrekord (+15,3 °C) ebenso wie die Wasserkuppe
(925 m, +12,7 °C; bisher: +12,3 °C). Deutlich kälter mit Höchstwerten
von nur +10 °C oder knapp darunter blieb es in Gebieten, wo sich länger
Nebel und Hochnebel hielten (z.B. Donauwörth-Osterweiler +9 °C), an
der Ostsee (z.B. Putbus/Rügen +10 °C) und in Teilen Thüringens und
Sachsens (z.B. Dresden +10 °C).
Am 26. kam die Kaltfront des Tiefs
weiter nach Südosten voran, konnte Deutschland jedoch nicht ganz überqueren
und wurde im Tagesverlauf wieder rückläufig. Bundesweit gingen die
Temperaturen zurück – im Flachland Süddeutschlands durch zunehmenden
Hochdruckeinfluss und damit verbundener Stabilisierung, in einem breiten
Streifen vom Saarland bis nach Brandenburg durch dichte Bewölkung und
etwas Niederschlag im Bereich der Front. Temperaturen über +15 °C
wurden noch in Teilen Baden-Württembergs (z.B. Mühlacker +16,9 °C,
Niederstetten +16,8 °C), in Sachsen (z.B. Chemnitz +15,7 °C) sowie
vereinzelt am bayerischen Alpenrand (z.B. Kempten +16,8 °C, Garmisch-Partenkirchen
+16,5 °C) gemessen. Letztgenannte Gebiete hatte die Front nicht erreicht,
und somit waren dort die Temperaturen im 850 hPa-Niveau noch am höchsten.
In Aue (Erzgebirge) wurde es mit +18,3 °C am wärmsten, gefolgt von
Attenkam (+17,7 °C) und Holzdorf (+17,2 °C). Einen Beleg für die
Wärme der Luftmasse lieferten die Bergstationen in diesem Bereich:
Der Große Arber (1446 m) im Bayerischen Wald stellte mit +13,7 °C
einen neuen Dekadenrekord auf, der 1215 Meter hohe Fichtelberg im Erzgebirge
verfehlte seinen aus dem Jahr 1970 mit einem Maximum von +14,1 °C
nur um zwei Zehntel Grad.
Ganztägiger Nebel herrschte einmal
mehr entlang der Donau. Dort kamen die Temperaturen an manchen Orten
nicht über +6 °C hinaus (z.B. Regensburg +5,9 °C, Neuburg +6,3 °C).
Bodendruckanalysen vom 24. bis zum 27.11.2006 und 850 hPa-Geopotential
und -temperatur vom 24. bis zum 27.11.2006,
jeweils 00 UTC:
Quelle: FU Berlin / DWD / Wetterzentrale
|
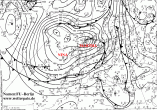 |
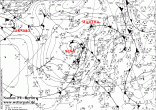 |
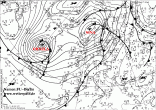 |
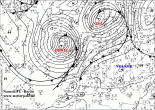 |
| 24.11.2006, 00 UTC |
25.11.2006, 00 UTC |
26.11.2006, 00 UTC |
27.11.2006, 00 UTC |
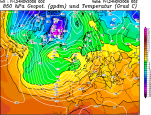 |
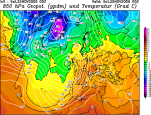 |
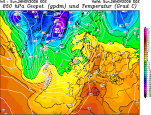 |
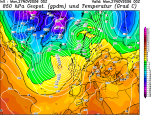 |
| 24.11.2006, 00 UTC |
25.11.2006, 00 UTC |
26.11.2006, 00 UTC |
27.11.2006, 00 UTC |
Tageshöchsttemperaturen
Die Seite
Dekadenrekorde
gibt Auskunft darüber, an welchen Stationen neue Rekorde der Temperatur
für die 3. Novemberdekade (21.-30.11.) aufgetreten sind.
 |
 |
 |
24.11., 18:00 UTC, MSG IR
Quelle: B. J. Burton |
25.11., 21:00 UTC, MSG IR
Quelle: B. J. Burton |
26.11., 18:00 UTC, MSG IR
Quelle: B. J. Burton |
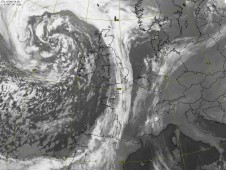 |
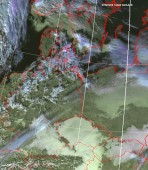 |
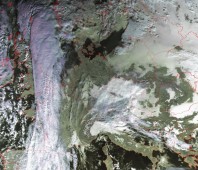 |
27.11., 06:00 UTC, MSG IR
Quelle: B. J. Burton |
27.11.06, NOAA 18 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |
28.11.06, NOAA 17 VIS
Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|
|
In Zusammenarbeit mit:
|

|
|

